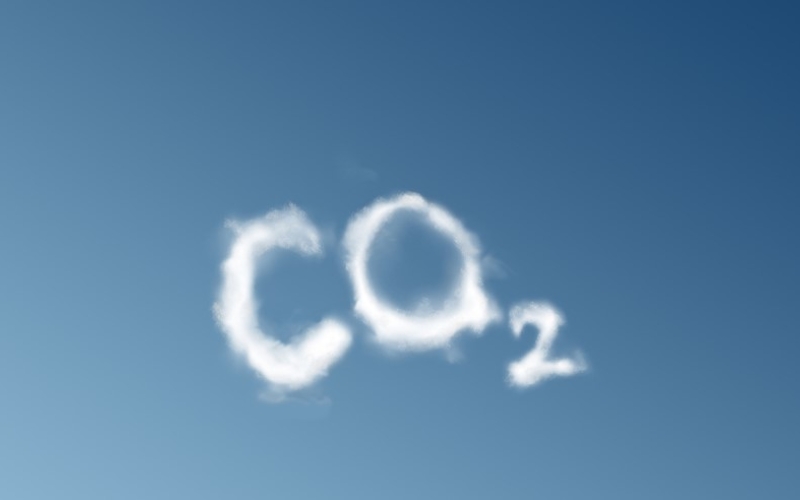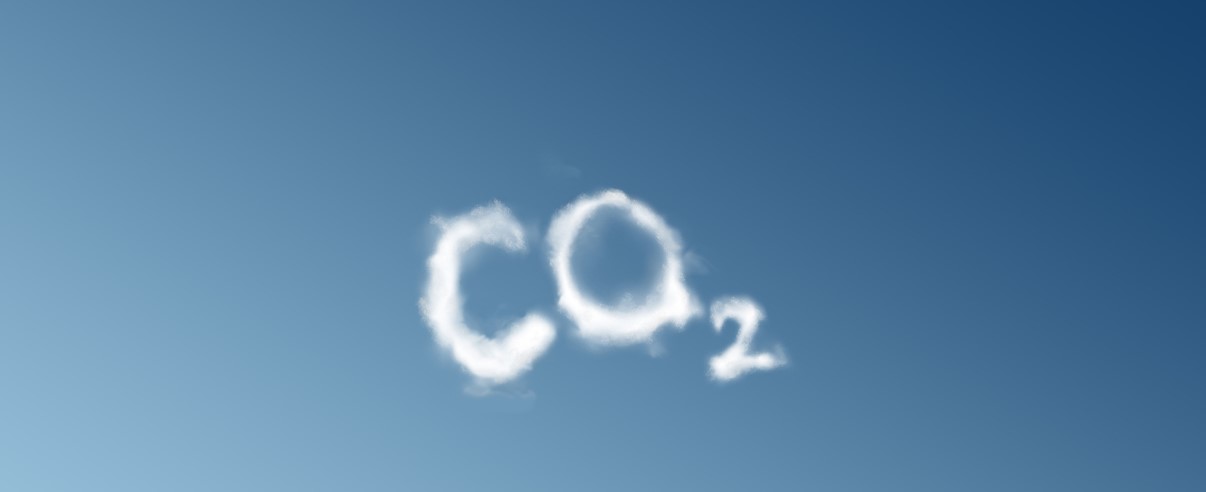Wir freuen uns, Ihnen heute einen exklusiven Einblick in unseren neuen Bereich Training & Consulting bei der SW Zoll-Beratung GmbH zu geben. Hierzu haben wir ein …
5 Fragen an Tim Mayer, VP Training & Consulting
Wir freuen uns, Ihnen heute einen exklusiven Einblick in unseren neuen Bereich Training & Consulting bei der SW Zoll-Beratung GmbH zu geben. Hierzu haben wir ein aufschlussreiches Interview mit Tim Mayer, unserem VP Training & Consulting, geführt, der uns hilft, die Vision und die Besonderheiten dieses spannenden Unternehmensbereichs näher zu beleuchten.
Redaktion:
Guten Tag, Tim! Vielen Dank, dass Du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Kannst du dich zunächst unseren Lesern einmal vorstellen?
Tim:
Guten Tag und vielen Dank für die Möglichkeit, mich und unseren neuen Bereich vorstellen zu dürfen. Als gelernter Elektroniker wurde ich wie die meisten Personen, die heute in Zollbereichen tätig sind, erstmalig nur zufällig mit Zollthemen konfrontiert. Während meines Elektrotechnik-Studiums durfte ich mich als Werkstudent in der Zollabteilung eines Maschinenbauunternehmens mit der Tarifierung von ca. 10.000 Materialien beschäftigen. Neben diesen Aufgaben durfte ich noch in weiteren Projekten unterstützen, sodass gegen Ende des Studiums die Frage im Raum stand, ob ich mir nicht weiter vorstellen könnte, mich weiter mit Zollthemen zu beschäftigen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das eine gute Entscheidung war, da ich aufgrund meines technischen Know Hows sehr gut für exportkontrollrechtliche Überprüfungen geeignet bin. Nach dieser Zeit durfte ich dann die Verantwortlichkeit für einen Zulieferer in der Automobilindustrie übernehmen und mich um die Zollbelange aller europäischen Standorte kümmern. Der Kontakt zu Schenker Deutschland und somit auch zur SW Zoll-Beratung waren für mich der ideale Weg um mich noch intensiver mit allen Belangen von unterschiedlichsten Unternehmen zu widmen. Diese täglich wechselnde Aufgabenstellung vom Kleinunternehmen bis zum Konzern über alle Brachen, Abgangs- und Empfangsländer hinweg, macht die Aufgabe unheimlich spannend.
Da es mir schon immer Spaß machte interne Schulungen zu den diversen Zollthemen zu planen, organisieren und durchzuführen, freut es mich umso mehr nun diesen Bereich bei der SW Zoll-Beratung führen zu können.
Redaktion:
Kannst du einmal erläutern, was den Bereich Training & Consulting auszeichnet?
Tim:
Der Bereich Training & Consulting ist eine spannende Erweiterung unseres bisherigen Dienstleistungsportfolios. Wir haben erkannt, dass der Bedarf an hochwertigen Trainingslösungen und fundierter Beratung bei unseren Kunden stetig wächst. Die Anforderungen in zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Themen wird immerhin nicht geringer. Mit unserem Angebot möchten wir genau diesem Bedarf gerecht werden und unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Herausforderungen zu meistern und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dabei geht es uns nicht nur darum Fachwissen zu vermitteln, sondern auch darum Unternehmen in der Organisation solcher Themen individuell zu unterstützen.
Redaktion:
Das klingt vielversprechend! Was hebt Euch als Dienstleister von anderen ab?
Tim:
Unser Alleinstellungsmerkmal liegt in der Verbindung von Fachkompetenz und individuell zugeschnittenen Lösungen. Zwar bieten wir auch Schulungen „von der Stange“ an, wollen unser Augenmerk allerdings auf individuell auf den Kunden zugeschnittene Beratungen und Schulungen legen. Hierfür planen wir die Erweiterung unseres Teams mit hochqualifizierten Experten, die bereits selbst unterschiedlichste Aufgaben in Organisation und Abwicklung von Zollprozessen bewältigt haben und somit praxiserprobte Lösungen anbieten können. Diese Expertise ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Trainings- und Beratungsansätze zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmt sind. Wir setzen nicht nur auf Standardlösungen, sondern arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre spezifischen Herausforderungen zu verstehen und darauf aufbauend die optimalen Lösungen zu entwickeln.
Die meisten unserer Dienstleistungen wollen wir aus eigener Hand anbieten, sodass wir immer auch die Qualität unserer Veranstaltungen im Blick haben. Dies bedeutet allerdings nicht, dass wir vollständig auf den Einsatz externer Experten verzichten.
Redaktion:
Das klingt nach einer äußerst kundenorientierten Herangehensweise. Welche neuen Produkte und Entwicklungen können wir von Ihrem Bereich Training & Consulting in Zukunft erwarten?
Tim:
Bereits in der Vergangenheit haben wir bereits eine Analyse der relevanten Zollprozesse bei unseren Kunden durchgeführt. Hierbei schließen wir uns ca. einen Tag lang gemeinsam mit den einzelnen Abteilungen des Kunden ein und analysieren, wie die Zollthemen bearbeitet werden. Dabei legen wir Wert auf eine sinnvolle Organisation, aber auch auf eine rechtmäßige Durchführung der Prozesse. Ebenso prüfen wir, ob die Anforderungen an vorhandene zollrechtliche Bewilligungen eingehalten werden oder ob es für unseren Kunden ggf. die Beantragung weiterer Bewilligungen sinnvoll ist. Während dieses Tages besprechen wir bereits Punkte bei denen der Kunde Quick-Fixes einfahren kann. Im Nachgang erhält er dann eine ausführliche, schriftliche Analyse seiner Prozesse sowie Handlungsempfehlungen für seine weitere Vorgehensweise. Dieses Angebot möchten wir nun weiter ausbauen.
Redaktion:
Das hört sich äußerst vielversprechend an! Wir sind gespannt auf die zukünftigen Entwicklungen. Gibt es abschließend noch etwas, das Sie unseren Lesern mitteilen möchten?
Tim:
Ich möchte noch einmal betonen, dass der Bereich Training & Consulting für uns nicht nur ein neues Geschäftsfeld ist, sondern vor allem ein Weg für unsere Kunden hin zu einer rechtmäßigen Abwicklung der leider zu oft stiefmütterlich behandelten Zollprozesse. Wir möchten einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und sie langfristig auf ihrem Weg zum Erfolg begleiten. Unsere Mission ist es, exzellente Dienstleistungen zu bieten und dabei die Bedürfnisse unserer Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen.
Redaktion:
Vielen Dank, Tim, für diese inspirierenden Einblicke in den neuen Bereich Training & Consulting bei der SW Zoll-Beratung. Wir wünschen Dir und Deinem Team viel Erfolg bei Euren zukünftigen Projekten!
Abschließend möchten wir uns bei unseren Lesern für ihr Interesse bedanken. Falls Sie weitere Fragen zum Bereich Training & Consulting haben oder mehr über unsere Dienstleistungen erfahren möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach!
Autor: Philipp Riesner, Project Management Office